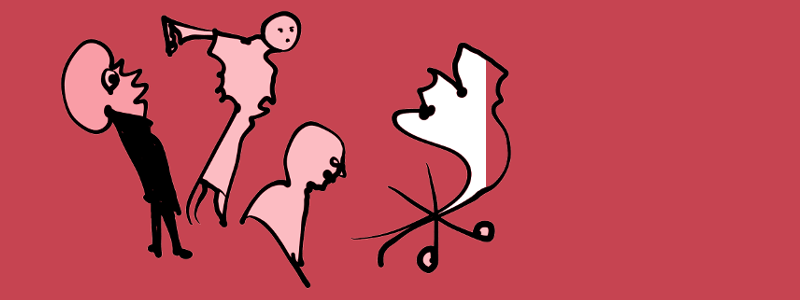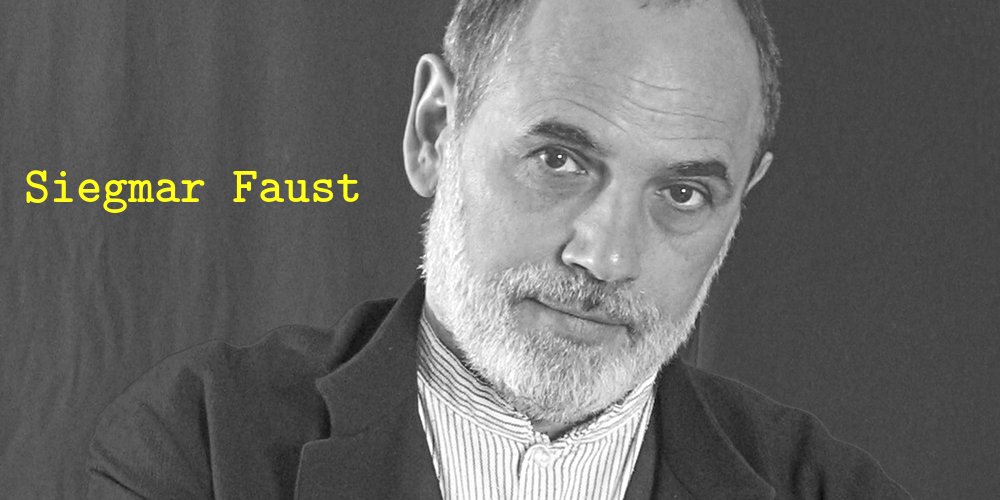Gleich vorweg: Die beiden abstrakten Begriffe ergeben nur in wechselseitiger Abhängigkeit einen Sinn. Besonders als Kind verspürten die meisten der im oder kurz nach dem Krieg Geborenen schon den Drang nach Freiheit insoweit, dass sie die von den Autoritäten (Eltern, Verwandte, Lehrer, Hausmeister, Polizisten etc.) durch Regeln und Bestrafungen gesetzten Grenzen zumeist erst durch Erfahrungen auszuloten suchten. Das Spielen oder das Stöbern in Ruinen und Bombentrichtern war besonders für Jungs reizvoll, obwohl die Eltern uns davor warnten, denn wir fanden noch Waffenteile, Munition verschiedenster Kaliber, später dann auf Feldern und in Wäldern auch Flugblätter in Russisch und Deutsch, die den Erwachsenen als gefährlich galten, weil sie mit dem Wind aus dem Westen kamen, also vom Klassenfeind stammen sollten.
Im Jahr 1953 geschah zweimal etwas Eigenartiges. Im März 1953 war ich als fast Neunjähriger nach dem Mittagessen bei meinem Hausfreund Hagen zum Spielen. Er war zwei oder drei Jahre jünger als ich und wohnte bei seinen Eltern mit zwei jüngeren Brüdern eine Etage unter uns. Es muss der Samstagnachmittag am 7. März 1953 gewesen sein, denn Hagens Vater Manfred, ein mürrischer Steinmetz, war gerade nach Hause gekommen. Am Sonnabend wurde nur bis Mittag gearbeitet. Dann klingelte es und unser kleinwüchsiger und glatzköpfiger Nachbar Walter, der Kino-Direktor, mit dem mein Pflegevater Skat oder Doppelkopf spielte, kam aufgeregt herein und warf sich dem muskulösen Manfred an die Brust.
»Weißt du schon? Stalin...«
Er krächzte:
»Väterchen Stalin...«
Beiden Männern flossen die Tränen. Sie konnten es nicht fassen und schluchzten. Ihr Gott Stalin hatte das Zeitliche gesegnet. Wir Jungs standen fassungslos daneben. Noch nie hatten wir Männer weinen gesehen. Beide waren die einzigen SED-Genossen im Haus. Ihr Gott war nun gestorben, einfach so, ohne Vorankündigung. Väterchen Stalin, der Generalissimo, der »große Freund des deutschen Volkes«, der »weise Führer aller Völker«, der »größte Mensch unserer Epoche«, wie der damalige Generalsekretär des Zentralkomitees der SED und Stalinist Walter Ulbricht meinte.
Als ich dann zu meinen Eltern hochging, erlebte ich das Kontrastprogramm. Sie waren gut gelaunt. Freuten sie sich etwa, dass Stalin, dessen Porträt auch in unserem Klassenzimmer hing, gestorben war? «Gott sei Dank« entfleuchte es meiner Mutter, als ich Stalin erwähnte. Vater guckte sie streng an. Sie schaltete einen Westsender an, der keine Trauermusik brachte, sondern fröhliche Tanzmusik. Sie konnten sich wegen mir nur verhalten über den Tod des »Ewig-Lebenden« freuen. Ich sollte es nicht mitbekommen, damit ich sie nicht in der Schule verraten könnte in meiner grenzenlosen Naivität, denn das konnte noch immer heißen: »Ab nach Sibirien!« Die brisanten Schlüsselworte meiner Kindheit hießen demzufolge: »Abgeholt« und »Abgehauen«.
Am 17. Juni desselben Jahres stromerte ich wieder einmal mit Schulfreunden an der Elbe herum, zumeist dort, wo die Müglitz in die Elbe mündete. Als ich zurückkam, wieder einmal mit schlechtem Gewissen, weil es schon später als erlaubt war, standen vor dem Rathaus ungewöhnlich viele Einwohner und hörten aufgeregt aufgeregten Rednern zu. Ich drängte mich durch die Massen auf dem Rathausvorplatz und lief dann noch 150 Meter die Bahnhofstraße hoch. Ich hastete die Treppen hinauf, Mutti öffnete die Tür, Vater drehte schnell das Radio aus. Sie sahen zwar äußerst besorgt aus, aber beachteten mich kaum. Sie schimpften gar nicht, obwohl ich doch fast eine Stunde zu spät zu Hause angekommen war. Haben sie wieder RIAS gehört? Das war der Sender im amerikanischen Sektor, wie ich später erfuhr, da uns in der Schule beigebracht wurde, dass dieser böse Rundfunksender ein Hetzsender der amerikanischen Imperialisten war.
Am nächsten Tag, das war ein Donnerstag, hingen überall in Heidenau Plakate herum mit der Überschrift »Befehl!« Darauf wurde von der sowjetischen Besatzungsmacht der Ausnahmezustand verhängt. Es war verboten nach 18 Uhr die Häuser zu verlassen. Am Tag durften nicht mehr als drei Personen in Gruppen auf den Straßen anzutreffen sein. Wir standen zu viert vor dem Plakat, als wir Vati gegen 17 Uhr vom Bahnhof abgeholt hatten. Auf dem Bahnhofsvorplatz sah ich zwei sowjetische Panzer, überhaupt das erste Mal Panzer in meinem Leben. Ich konnte mit meinen achteinhalb Jahren bereits bis vier zählen und guckte Vater besorgt an. Er nahm mein Schwesterchen Gabi, also seine Tochter auf den Arm und sagte: »Ihr seid ja noch keine Personen.«
Ich wollte protestieren, doch mehr interessierten mich die Panzer. Aber Mutti zog mich am Arm nach Hause. Ein Arbeitskollege meines Vaters, der auch in Heidenau wohnte und ebenfalls zwei Kinder hatte, wurde wegen aktiver Teilnahme an den Protesten am 17. Juni 1953 nach Sibirien verschleppt und tauchte nie wieder auf. Mit Joachim, dem größeren der beiden Söhne, war ich einige Male zusammen im Kinderferienlager.
Kurz nach dem Volksaufstand 1953, von dem ich erst später in der Schule erfuhr, dass es ein von den westdeutschen Feinden angezettelter »faschistischer Putschversuch« gewesen sein soll, kam mein Vati nicht von der Arbeit zurück, tagelang, wochenlang, monatelang. Meine Mutter weinte bei jeder Nichtigkeit. Sie wurde wortkarg und erklärte nur, Vati wäre auf Dienstreise. Dass mein Vater »abgeholt« worden war, dass erfuhr ich erst als junger Erwachsener von meinen Tanten. Ob er wenige Monate nach Stalins Tod als Angestellter des Bezirksfinanzamtes zu Dresden irgendetwas ausgefressen hatte oder einfach nur nach Dienstschluss unter die Masse von Demonstranten geraten war, die am 17. Juni 1953 auch in Dresden gegen das SED-Regime protestiert hatten, das weiß ich bis heute nicht.
* * *
In dieser Zwiespältigkeit zwischen Familie und Schule, zwischen Privatleben und Staat sind nicht wenige Schüler in der SED-Diktatur aufgewachsen. Es sind wenige, die sich dann zumeist in der Pubertät gegen ihre Familie und gegen die meisten Freunde entschieden haben. So auch ich, indem ich mich auf der Dresdner Kinder- und Jugendsportschule zusätzlich neben meinem früh ausge-prägten Interesse für bildende Kunst und Literatur noch mit Karl Marx abplagte. Das folgende Gedicht drückt meine damalige Stimmung ziemlich authentisch aus:
FRAGEN VOR DEM ABITUR
Was bin ich?
Ein Mensch bin ich.
MENSCH – Wie stolz das klingt! (Gorki)
Bin ich nun einer oder bin ich keiner?
Ja, ja, bestimmt – doch nur ein kleiner.
Ich bin zwar einsdreisiebzig groß,
doch sonst ist nicht viel mit mir los,
fress achtzehn Jahre schon vom Brot der Menschensippe
und nicht ein Dankeswort kam über meine Lippe...
Wo ich doch genau weiß
dass ich ein Mensch bin –
jung und gesund:
das sagt mein Mund
das riecht meine Nase
das sehen meine Augen
das hören meine Ohren
das tasten meine Hände
Zweifellos
ich bin ein Mensch –
bloß
was für einer?
Wie bin ich?
Wer bin ich überhaupt?
Mein Ich hat gelernt:
zu sprechen
zu lesen
zu schreiben
zu rechnen
etwas
dialektisch zu denken
bewusst zu sehen
auch zu
lieben und zu hassen.
Kurz:
alles nach dem neuesten Maß
der Menschen zu tun.
Na und?
Was wird aus mir?
Was soll nun werden?
Aus mir wird kein Exquisitladenkäufer
kein starker Raucher, auch kein Säufer
kein Handwerker mit übergroßem Magen
kein Funktionär mit Chauffeur und Wagen
kein Herr Direktor mit gehornter Brille
kein Politiker mit unbeugsamem Wille'
kein Mörder
kein Dieb
Oho!
Was kann ich denn sonst noch werden?
Ach ja!
Künstler und Kommunist will ich ja werden,
aber ein richtiger!
Anschließend flog ich zweimal wegen Gedichten vom Studium, obwohl ich mich als Jungmarxist empfand. Das hatte zur Folge, dass ich mich nach dem Desaster am Institut für Kunsterziehung konsequent vom Malen entfernte, niemals wieder einen Pinsel anrührte und mich seitdem nur noch dem Schreiben widmete. Bei der zweiten vorzeitigen Exmatrikulation vom Leipziger Literaturinstitut spielte die Erwähnung vom 17. Juni 1953 in einem Gedicht die entscheidende Rolle. Zeitgleich wurde ich auch als Kandidat der SED gestrichen, was in mir einen solch’ inneren Schmerz auslöste, dass ich zumindest für ein paar Stunden bereit war, aus dem Leben zu fliehen. Die Stasi kam als Retter und wollte mir helfen, wenn ich ihr helfen würde. Fünfmal traf ich mich mit ihnen, jedoch mehr aus Neugier, um sie kennenzulernen, was schwer war, denn sie waren verschlossen und gaben sich dumm. Aber so schlau war ich schon, ihnen nichts zu unterschreiben, nicht einmal eine Schweigeverpflichtung, geschweige denn eine Verpflichtungserklärung. Dafür bekam ich bald, wie sie mir androhten, die Macht der Arbeiterklasse zu spüren. Zum Glück hatte ich gute Freunde, mit denen ich einen Künstlerkreis nach dem Vorbild der französischen Künstlergruppe »Nabis« bilden konnte, der mir vorerst Halt gab, denn wir versprachen uns lediglich, der Kunst treu zu bleiben.
In der Messestadt Leipzig kamen wir mit den Strömungen der 68er aus dem Westen in Berührung. Rings um die DDR herum blühten die Rebellionen auf, vor allem unter Studenten. Im Westen wollten sie nach den Vorbildern von Marx, Trotzki, Mao oder Ché Guevara das kapitalistische System hinwegfegen, wohingegen sich die rebellische Jugend in Warschau oder in Prag nach den westlichen Freiheiten und Menschenrechten sehnten. Mein Herz schlug damals für den »Sozialismus mit menschlichem Antlitz«, wie er vorerst im »Prager Frühling« propagiert worden war.
* * *
Vieles musste ich doppelt erleben, um einigermaßen klug oder reif zu werden. So erlebte ich zwei Inhaftierungen wegen sogenannter »staatsfeindlicher Hetze«, immer im Zusammenhang mit der Forderung nach Freiheiten und Menschenrechten. Für das Letztere gab es immerhin einen Maßstab: die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948. Als die DDR 1973 in die UNO aufgenommen wurde, berief ich mich auf den Artikel 13, in dem es heißt: »Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in sein Land zurückzukehren.« Nachdem meine erste Ehe mitten in einem Leipziger Stasi-Vernehmerzimmer ohne Aussprachemöglichkeit geschieden worden war, bot man mir 1972 die Ausreise in die BRD an. Ich wollte weder meine drei Söhne noch meine Künstlergruppe verlassen, obwohl auch die Sehnsucht nach dem mir unbekannten Westen in mir gestiegen war. Doch mein Trotz sagte mir: Wenn die das wollen, dann willst Du das schon lange nicht!
Nach meiner Entlassung aus der Leipziger Stasi-Untersuchungshaft ohne Anklageerhebung durch »Erichs Krönungsamnestie« musste ich mich als Transportarbeiter bewähren. Den Zynismus, den ich während der Stasi-Vernehmungen erfuhr, heilte mich von meiner Illusion, dass es eine humane Diktatur des Proletariats geben könne. Doch die Feindbilder, die uns in der Schule und sonst wo gegen den Kapitalismus eingepflanzt worden waren, erloschen auch nicht so schnell. Und so ergab sich eine gefährliche Situation ohne festen Grund unter den Füßen. Doch bald entschied ich mich mit meiner zweiten Frau zum Menschenrecht der Ausreise. Dem wurde in der Abteilung Inneres vom Rat des Kreises widersprochen. Ebenso bei einem Bekannten, der bald zum Mitstreiter wurde, obwohl er einst selber kurzzeitig für die Stasi gespitzelt hatte. Wir ließen uns nicht abspeisen und sammelten Unterschriften gegen die Verweigerung der Menschenrechte. 45 Unterschriften waren dem Dresdner Bezirksgericht in meinem Fall dann viereinhalb Jahre wert.
Im Zuchthaus Cottbus, wie die Strafanstalt von den Häftlingen genannt wurde, lernte ich tolle Haft-kameraden kennen, denn ungefähr 80% waren hier aus politischen Gründen eingesperrt, zumeist wegen Fluchtversuchen. Es war schnell festzustellen, dass jene Politischen, die den verschiedensten christlichen Religionsgemeinschaften angehörten, mit Leid besser umgehen und Haftkameraden in der Not besser beistehen konnten. Das beeindruckte mich. Obwohl fast die Hälfte der Häftlinge Hochschulreife und hochqualifizierte Berufe besaß und es deshalb oft auch Parteigenossen waren, herrschte hier, besonders genährt durch die brutalen und dummdreisten Erziehungsmethoden des Strafvollzugs, ein knallhartes antikommunistisches Klima. Wer konnte nach Erfahrungen mit den fiesen Stasimethoden noch die DDR als demokratische Republik ernst nehmen? Also hieß sie hier wie früher zu Adenauers Zeiten einfach »Zone«. Fast jeder wollte freigekauft werden, hatte also Ausreiseanträge gestellt und sang gern das verbotene Cottbus-Lied:
»Nach dem Westen strebt das Sehnen,
dorthin, wo man Freiheit kennt,
uns verbindet nichts mit denen,
deren Macht nur Leben hemmt...«
Wegen solcher Gesänge wurde ich von meinem »Erzieher« Hoffrichter mit einem ausziehbaren Schlagstock zusammengeschlagen, bis ich blutend am Boden lag. Nicht zu Unrecht wurde er »Urian« genannt, wohingegen er als IM einen harmloseren Decknamen trug. Dennoch riskierte ich, eine handgeschriebene Häftlingszeitung »Armes Deutschland« herzustellen, die sich als Gegenstück zur SED-Parteizeitung »Neues Deutschland« verstand, wissend, dass diese nach dem Vorbild der Weißen Rose ausgerichtete Aktion mir zwar nicht den Tod, jedoch fünf Jahre »Nachschlag« einbringen konnte. Rückblickend würde ich das heute als verantwortungslos bezeichnen, vor allem, da ich für mittlerweile vier Kinder zu sorgen hatte. Dank der Klugheit und des Mutes einiger Haftkameraden kam keines der von Hand zu Hand weitergereichten DIN-A-4-Exemplare in die falschen Hände, so dass die Sache zwar bekannt wurde, aber kein Beweis vorlag und ich nicht noch einmal verurteilt werden konnte, sondern nur isoliert wurde. So durfte ich nach meinen insgesamt 347 Tagen Einzelhaft in den Stasi-Untersuchungshaftanstalten Leipzig und Dresden weitere 401 Tage in kalten, zumeist feuchten Kellerzellen in Cottbus verbringen, inklusive 63 Tage Arrest bei drei Scheiben Brot, früh und abends ein Getränk und aller zwei Tage eine Suppe. So wurde ich nicht nur durch Hunger und Kälte gequält, sondern auch dadurch, dass man auf einem Lattenrost ohne Matratze lediglich mit einer schmutzigen Decke zu schlafen hatte. Tagsüber 16 Stunden ohne Sitzplatz, nur in der Zelle herumlaufend, ohne Lese‑ oder Kontaktmöglichkeiten zu anderen Häftlingen.
Besonders in dieser Zeit musste ich immer wieder an meinen väterlichen Freund Heinz Kucharski denken, der als Indologe »eine zentrale Persönlichkeit des Hamburger Zweigs der Weißen Rose« gewesen sein soll und einigen von uns den Buddhismus und einige Yoga-Übungen nahegebracht hatte. Er saß bei der Gestapo vom November 1943 an in Einzelhaft und wurde im April 1945 zum Tode verurteilt. Auf dem Weg zur Hinrichtung konnte er jedoch fliehen. Ich war stolz, einen solchen mutigen Kämpfer gegen den Nationalsozialismus, der in Leipzig als Lektor ansässig war, in unsere Künstlergruppe geholt zu haben, für den ich sogar von ihm gewünschte Bücher aus der Deutschen Bücherei entwendet hatte, als ich dort vor meiner 1. Verhaftung als Nachtwächter tätig war. Neben der Sehnsucht nach meiner Familie war Kucharski derjenige, der mir durch sein Vorbild die Kraft zum Überleben geschenkt hatte. Es war in der Zelle verboten, Kraftübungen oder Gymnastik zu betreiben. Ich stand jedoch jeden Morgen gefühlte zehn Minuten bewegungslos auf dem Kopf, woran sich die Wärter erst gewöhnen mussten.
(Ein großes Glück war, dass ich damals noch nicht wusste, dass Kucharski schon in der 1. Diktatur ein Verräter war und über 30 Freunde und Verwandte der Gestapo preisgegeben hatte, von denen acht nicht überlebten. In der 2. deutschen Diktatur war er ein fleißiger und mehrfach ausgezeichneter Stasi-Mitarbeiter, der mithalf, dass allein aus unserer Künstlergruppe vier im Gefängnis landeten, drei davon auch im Zuchthaus Cottbus, wo 30 Jahre zuvor schon neun von ihm verratene Frauen einsaßen, darunter auch seine Mutter, seine Verlobte Margaretha Rothe, seine Lehrerin Erna Stahl und seine Klassenkameradin Traute Lafrenz, die als letzte Überlebende der Weißen Rose in den USA lebt.)
Durch die kluge Hilfe von Haftkameraden konnte ich in der Kellereinzelzelle durch hereinge-schmuggeltes Papier sowie Kugelschreiberminen weiterhin das »Arme Deutschland« produzieren, denn hier lebte ich natürlich etwas bequemer als im Arrest und durfte auch alle 14 Tage ein Buch aus der Knastbibliothek lesen und fast täglich das »Neue Deutschland«. Das hat nicht nur meinem Leben in der Isolation einen Sinn gegeben, sondern auch meinen Haftkameraden, wie ich durch einen Brief von Detlef Seyffarth erfuhr, der mir im Dezember 1976 dankend schrieb: »Die Gespräche mit Dir in Cottbus, die Lektüre des ARMEN DEUTSCHLAND u.a. gehörten zu den Dingen, die der Zeit in Cottbus einen bleibenden Sinn gaben.«
* * *
Die Sehnsucht nach Freiheit ist wohl in der Gefangenschaft neben der Sehnsucht nach den engsten Verwandten und Freunden das Hauptthema sowohl der Gefühle als auch der Gedanken. Doch diese aufgestaute Sehnsucht kann auch zur Verzweiflung treiben, die eine schmerzhafte innere Unruhe verursacht und zerstörerisch wirkt. Solchen Ansätzen versuchte ich mit inneren Reflexionen zu be-gegnen, um den auch immer wieder aufkommenden Hass gegen meine Peiniger wieder auflösen zu können. Not lehrt beten heißt es, was ich nur bestätigen kann. Immer wieder fragte ich mich, wie das Jesus mit der Feindesliebe gemeint haben kann. Politische Gegner könnte ich lieben, denn das sind Menschen, die mich wie Konkurrenten zu Höchstleistungen antreiben. Der Streit zwischen Gegnern ist in einer Demokratie das Normale und ein wesentlicher Teil unserer Freiheit. Doch Feinde sind Freiheitsvernichter bzw. Unmenschen, die meinen Liebsten und mir nach dem Leben trachten. Die soll ich lieben? Unmöglich! Zwar wollte ich nicht auf das Niveau derer sinken, denen der Hass gegen den Klassenfeind förmlich aus den Augen sprühte, aber wie sollte man solchen Feinden begegnen? Mit Witz und Intelligenz? Mit Gandhis gewaltlosem Widerstand? Mit traurigem Wegducken?
Martin Luther King meinte einst, Feindschaft werde durch Hass nur vervielfacht; sie zerstöre nicht nur den Gehassten, sondern auch den Hassenden. »Nur Liebe zum Feind könne diesen in einen Freund verwandeln und so die Feindschaft überwinden.« Ich versuchte das mehrfach gegenüber den Uniformierten anzuwenden, aber es blieb völlig unwirksam. King wurde erschossen und ging in die Geschichte ein; ich wurde lediglich gequält und ging daraus gestärkt hervor. Seine Feinde zu lieben hieße auch den Teufel lieben zu müssen – oder? Nur eins würde ich beherzigen, mich nie auf das niedere, höllische Niveau von Feinden zu begeben. Ich würde mich nie rächen wollen, indem ich sie ebenso, wenn es die Gelegenheit zuließe, mit einem Schlagstock zu Boden prügeln würde, wie sie es mit mir antaten. Aber ich würde sie nie verharmlosen, sondern vor ihnen warnen. Es sei denn, sie entschuldigten sich oder änderten sich, dann würde ich jedem die Hand zur Versöhnung hinstrecken. Wirklich? Auch wenn ich hätte mit ansehen müssen, wenn ein Krieger meiner Frau und unseren Kindern vor meinen Augen den Kopf abgeschnitten hätte? Solchen Fanatikern soll ich verzeihen, sie gar lieben? Also auch Hitler und Stalin?
Die Sehnsucht nach Freiheit keimt besonders intensiv in Notlagen auf; im Krieg sehnt sich wohl jeder besonders nach Frieden. Beides ist die Voraussetzung für ein humanes Leben. Reicht das? Mir nicht, denn ich sympathisiere heute sehr mit dem auf Befehl Hitlers hingerichteten Dietrich Bonhoeffer, der als verantwortungsbewusster Christ in seiner Zelle schrieb:
»Ziehst du aus, die Freiheit zu suchen, so lerne vor allem
Zucht der Sinne und deiner Seele, dass die Begierden
und deine Glieder dich nicht bald hierhin, bald dorthin führen.
Keusch sei dein Geist und dein Leib, gänzlich dir selbst unterworfen,
und gehorsam, das Ziel zu suchen, das ihm gesetzt ist.
Niemand erfährt das Geheimnis der Freiheit, es sei denn durch Zucht.
Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen,
nicht im Möglichen schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen,
nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit.
Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens
nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen,
und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend umfangen…«
Da ich 1976 nach meinem Freikauf durch die Bundesrepublik rasch die Vorteile einer freien demokratischen Wohlstandsgesellschaft kennen und lieben lernte, kam ich bald viel im Lande als Zeitzeuge herum, um vor allem jungen Menschen anhand meiner kontrastreichen Erfahrungen die Vorzüge der Demokratie bewusst zu machen, die ihnen oft zu selbstverständlich waren. Natürlich bin ich ein Gegner aller Sozialismus-Varianten geworden, vor allem seitdem ich mich mit den Erfindern der sozialen Marktwirtschaft, den Ordoliberalen beschäftigt hatte, zu denen u.a. Walter Eucken, Alfred Müller-Armack, Alexander Rüstow und Wilhelm Röpke gezählt werden.
Dass ich von Journalisten, die mir mit einem übers ganze Land gespannten Zeitungsnetz und zudem über den Deutschlandfunk falsche Absichten und gefälschte Sätze in den Mund legten, ins Abseits und damit auch in eine gewisse Armut gedrängt wurde, regt mich kaum noch auf. Ich habe, wie angedeutet, schon ganz andere Situationen überstanden. Meine Angst hält sich also in Grenzen, obwohl ich Annäherungen an das überwunden Geglaubte seit einigen Jahren deutlich spüre. Freilich, eine Demokratie ist nicht das Himmelreich auf Erden, aber sie wartet gern unerwartet mit Überraschungen auf. Auch mit guten, die ich durch die Hilfe ehemaliger Haftkameraden erfahre, die mich und meinen Lebensmut moralisch, geistig und materiell unterstützen. Das ist eine Antwort, die sowohl zur Verantwortung als auch zur Freiheit in Demut regelrecht verführt.